Von der „Zettelwirtschaft“ zum Service durch Datenauswertung, von „Patientenreisen“, vollen Wartezimmern oder Ambulanzen für Routinechecks zur Telemedizin, von PDF-ELGA zu ELGA als Betriebssystem des österreichischen Gesundheitswesens — ohne Digitalisierung gibt es wohl keine Zukunft. Bei den PRAEVENIRE Gesundheitstagen im Stift Seitenstetten waren ZUKUNFTSAUSSICHTEN, CHANCEN UND UMSETZUNG das große Thema.
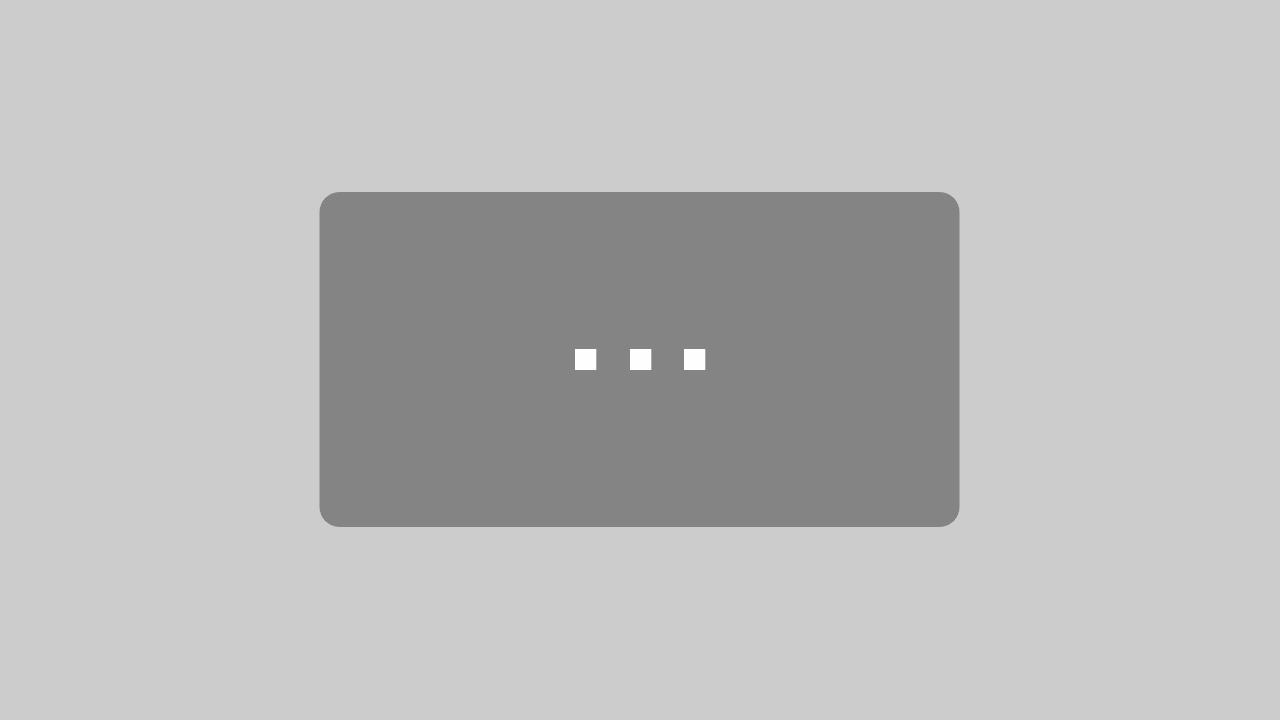
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Bereits in den Arbeiten für das PRAEVENIRE Weißbuch „Zukunft der Gesundheitsversorgung“ (Version 2020) haben sich Expertinnen und Experten eingehend auch mit den Aspekten der Digitalisierung aller Lebensbereiche — Gesundheit und Gesundheitswesen sind da keine Ausnahme — auseinandergesetzt. Prof. Dr. Reinhard Riedl, Leiter des BFH-Zentrums Digital Society an der Berner Fachhochschule (BFH): „Drei Empfehlungen wurden formuliert: Der Mensch als Entscheider muss gestärkt werden, der Zugang zu relevanten Daten muss ermöglicht werden und die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitswesen und Tech-Sektor muss verbessert werden.“
Zehn Gestaltungskriterien sind wohl für einen Erfolg entscheidend:
Patientenzentrierung
Orientierung am Gesundheitsfachpersonal
Fokussierung auf Informationsflüsse
Verstärkte Nutzung von Augmented Intelligence
Anleitung durch Good Practices
Einbeziehung aller ohne Blockaden
Sicherheit und Solidarität
Interoperabilität und hohe IT-Maturität als Normalfall
Gute Ausbildung, permanente Weiterbildung und Kristallisationspunkte
Autonomie und internationale Zusammenarbeit
Personal (siehe 1. und 2.), Technik (siehe 3. und 4.) sowie zahlreiche andere Bedingungen spielen hier zusammen. Den wohl größten Einfluss auf die zukünftige Entwicklung und die Entschei- dungsgewalt darüber, ob eine Digitalisierung des Gesundheitswesens in Österreich möglich wird, haben Patientinnen und Patienten und das Gesundheitsfachpersonal. Wenn nicht deren persönliche Interessen (Patientennutzen) und Vorteile in Form einer besseren und leichteren Berufsausübung in den Vordergrund gestellt und klar erkennbar werden, werden die Projekte wohl nicht akzeptiert werden.
Nicht zu sehr simplifizieren!
Auf dem Weg in die Digitalisierung des Gesundheitswesens gilt es auch, eine Gratwanderung zwischen einem Sich-Verheddern in der Komplexität und einer Übersimplifizierung zu vermeiden. Riedl: „Wenn wir wirklich erfolgreich sein wollen, dürfen wir die Komplexität der Aufgaben nicht zu sehr verkürzen.“ Die Coronapandemie könnte jedenfalls ein passender Ausgangspunkt für die Reise in eine digitale Zukunft sein: ein Übergang von der konventionellen Versorgung in Richtung „Blended Care“. „Die Idee von ‚Blended Care‘ ist sehr verwandt mit den Dingen, die wir im Zuge der Coronapandemie bereits gesehen haben“, sagte der Experte. Das heißt beispielsweise: telemedizinische Versorgung wie digitalisierte Daten sowie Abläufe in der Gesundheitsversorgung — auch längerfristig ermöglichen. „Patientenreisen“ wurden im Rahmen der COVID-19-Krise aus im Grunde uralten seuchenhygienischen Gründen tunlichst vermieden. Telemedizin war angesagt. Das kann Wartezeiten verkürzen, die Betreuung der Patientinnen und Patienten vereinfachen und dabei helfen, persönliche Ärztinnen- und Arztbesuche oder Ambulanzbesuche auf das wirklich nötige Maß zu reduzieren. Integration weiterer Leistungen, Telemedizin, regelmäßige Datenerfassung und nützliche Apps sind hier — in Ergänzung zur konventionellen Versorgung — Mittel, um zum Gesundheitswesen der Zukunft zu kommen. „Im Zentrum steht die Patientin oder der Patient. Am Ende soll die Patientin oder der Patient eine bessere Versorgung haben. Das Ergebnis soll eine höhere Effektivität — optimalerweise bei sogar geringeren Kosten — sein, hieß es in Seitenstetten.
Objektiv messbare und nachhaltige Wirkung, Verbesserung der PROMs (Patient Reported Outcome Measures) und Akzeptanz durch das Gesundheitsfachpersonal sind der an diese Initiativen anzulegende Maßstab. Aktive Einbeziehung der Patientinnen und Patienten mit je nach ihrer Situation verbesserter Versorgung und besseren Therapien bei geringeren Kosten stellen das Ziel dar. Und die Mittel: Apps und Devices, Telemedizin sowie Remote Intelligence. Analysiert man die Mittel, mit denen das alles erreicht werden kann, kommt man schnell auf fünf Kategorien:
Apps:
Schon ein digitalisiertes Gesundheitstagebuch kann den Status der Patientin oder des Patienten bestimmen helfen und im Zweifelsfall — automatisiert — zu einer Reaktion des Gesundheitswesens bei allfälligerweise auftauchenden Problemen führen.Devices:
Monitoring bei chronischen Erkrankungen (Dauertherapie) und in der Nachsorge. Gleichzeitig können intelligente Devices akut potenzielle Krisensituationen antizipieren und eine Risikoreduzierung erleichtern.Telemedizin:
Der Besuch beim bzw. durch den Hausarzt bei einer Influenza kann durch telemedizinische Konsultationen ersetzt werden. Routinekontrollen lassen sich auf diesem Weg ebenfalls durchführen.Remote Intelligence:
Erstmals ergibt sich durch telemedizinische Anwendungen die Möglichkeit einer schnellen Einbeziehung von Spezialisten — zusätzlich z. B. zum routinemäßig behandelnden Arzt, um die Expertise in der Patientenversorgung zu erhöhen. Eingriffe auf Distanz sind kein „Science-Fiction“-Programm mehr.Lebensunterstützung:
Organisationshilfen und Unterstützung für Menschen, die nicht die optimalen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Gesundheitswesens haben, könnten dem Einzelnen den Nutzen von digitalisierter Medizin deutlich vor Augen führen. Persönliche Begleitung wird flächendeckend möglich.
Potenzial situationsabhängig
Was die Digitalisierung aller betroffenen Systeme auszeichnet, trifft auch auf die Digitalisierung zu: Flexibilität, was Aufwand und Nutzen je nach der Situation betrifft, in der sie zum Tragen kommt. „Das Potenzial hängt von der Situation ab“, sagte Riedl. Beispiele: Auf den Ebenen der Institutionen — Hausarzt, Primärversorgungszentrum, Ambulanz, Krankenhaus — kann jeweils unterschiedlich und in den verschiedensten Abläufen von „Blended Care“ profitiert werden. Das gilt aber auch für den Grad der Schwere einer Erkrankung (Patientin oder Patient mit akutem Bedarf, chronisch Kranke) oder für die medizinischen Fachgebiete (Psychiatrie, Onkologie etc.). Die möglichen Anwendungen erstrecken sich auch über die Phasen der medizinischen Versorgung — von der Anamnese bis zur Nachsorge. Und schließlich könnte sich eine Neudefinition von „wohnortnah“ ergeben — ein „Wunderwort“, das womöglich völlig neu zu denken ist.
ELGA ohne „Datenfriedhof“
Die elektronische Gesundheitsakte ELGA hatte es bisher — vorsichtig formuliert — nicht ganz ganz leicht in Österreich. In Zeiten der Digitalisierung könnten sich deren Grundlagen und Rollen vollständig wandeln. „Es geht um die Perspektive der Papierlosigkeit“, hieß es in Seitenstetten. Es ist die Veränderung der Speicher- und Analyseverfahren, die in der Zukunft erfolgen dürften: von der Patientenakte in Papierform zur aktuellen ELGA-Lösung mit dem Aufrufen von PDF-Dateien (Kritiker: „PDF-Friedhof“) zu ELGA als einem Betriebssystem mit nutzenorientiert Steuerung der Informationsflüsse. Nutzenorientiert, das bedeutet natürlich auch nutzerorientiert. Von der Makro- zur Mikroebene: Gerade COVID-19 hat gezeigt, dass ein Epidemiemanagement in einem digitalisierten System wesentlich schneller, effizienter und einfacher sein könnte. Für die Zukunft gilt es aber auch, für Wissenschaft und Anwendungen Daten aus Registern zugänglich und analysierbar zu machen. Patientinnen und Patienten wiederum profitieren von der Verfügbarkeit ihrer Gesundheitsdaten — sie stammen aus immer mehr verteilten Quellen — in Diagnose und Therapie. Wobei in Sachen Datenschutz vom Übergang von der alten „Zettelwirtschaft“ zum digitalen Datenschatz wiederum unterschiedliche Maßstäbe anzulegen sind. „Man dachte, Papierarchive seien gut geschützt. Da ging es um die Berechtigung und den Nachweis der Benutzung durch einzelne Personen mit entsprechender Berechtigung“, betonte Riedl zu dieser Sachfrage. Anscheinend „geschützt“ waren die Daten vor allen durch ihre physische Verstreutheit über viele Institutionen und über die aus der „Papierwirtschaft“ resultierenden — oft mit erheblichen Nachteilen verbundenen — Unmöglichkeit einer Zusammenführung der Informationen — zum Guten wie zum Schlechten. Die heute verwendete ELGA-Form steht in diesem Zusammenhang als eine Zwischenstufe zu einem vollends digitalisierten System gar nicht so schlecht da, hieß es bei den PRAEVENIRE Gesundheitstagen: „Unbefugte können Datenpakete zur selben Person nicht als zusammengehörend erkennen.“ Bei ELGA als Betriebssystem geht es vor allem um eine Architektur, welche Datenflüsse ermöglicht und gleichzeitig deren Verwendung unter sicheren Bedingungen garantiert. „Wir brauchen eine klar definierte Governance. Wer darf was und wozu“, erklärte Riedl.
Die Digitalisierung im Gesundheitswesen soll vor allem Kollaborationen ermöglichen und die Zusammenarbeit aller Beteiligten stärken — für bessere Ergebnisse und effizienteres Arbeiten.
Reinhard Riedl
Teilhabe aller Beteiligten
Wiederum gibt es Maßstäbe, Ziele und Mittel zur Erreichung der Ziele: Die Patientinnen und Patienten stehen im Mittelpunkt — also müssen für sie die Kontrolle über die Informationen und der Schutz der Privatsphäre gesichert sein. Erkennen die Patientinnen und Patienten ihren Nutzen, werden sie zur Teilnahme bereit sein. Ähnliches gilt für das Fachpersonal des Gesundheitswesens: Effizientes und effektives Arbeiten bringt die Motivation, sich zu beteiligen. Und schließlich können die im System enthaltenen Daten auch die Grundlage für die Wissenschaft sein. Man denke nur an relativ einfache Versorgungsplanung, id est das zeitnahe Anpassen von Betreuungsangeboten an sich ändernde Bedürfnisse. Die Ziele: auf besseren und umfassenderen Informationen basierende Diagnosen und Therapien, eine umfassendere Wirkungsforschung und im Pandemiefall eventuell zeitnaher und weniger belastend ausfallende Restriktionen. Dazu bedarf es auf die jeweiligen Situationen und Bedürfnisse angepasster Benutzerschnittstellen, eines Ausbaus der Nutzungsszenarien und schließlich der Governance-Kriterien. Sicherheit und Solidarität, Interoperabilität, Good Practices als Vorbild sowie Einbeziehung aller Beteiligten sind einige der notwendigen Gestaltungsprinzipien, auf denen darauf basierende Forschungsaktivitäten mit Augmented Intelligence, Künstliche Intelligenz (KI) etc. schließlich aufsetzen könnten.
Zweiwegkommunikation erforderlich
„Man braucht ‚multidisziplinäre Köpfe‘, keine Insellösungen. Vor allem sollte es ein gemeinsames Commitment geben“, lautete der Tenor einer der Arbeitsgruppen in Seitenstetten.“ Wichtig sei aber auch, dass durch solche Systeme die persönliche Gesundheitskompetenz des Einzelnen verbessert werden könnte. Entscheidend für die Entwicklung von ELGA zu einem echten Betriebssystem für das Gesundheitswesen ist aber noch ein weiterer Faktor, wie Experten bei den PRAEVENIRE Gesundheitstagen feststellten: Eine Schwachstelle der aktuellen Lösung liegt noch darin, dass es sich vor allem um ein Einwegsystem handelt, das allem voran vom Einspeichern von Informationen durch das Gesundheitsfachpersonal lebt. Doch über den e-Impfpass, die e-Medikation und den e-Befund ergeben sich bereits jetzt Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung, von der die Patientinnen und Patienten direkt erkennbaren Nutzen haben können.
Teilnehmende (in alphabetischer Reihenfolge)

● Assoc.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Martin Andreas, MBA, PhD
● Mag. Christoph Baldinger
● Dr. Alexander Biach
● Prof. Dr. Joachim M. Buhmann
● Dr. Irene Fialka
● FH-Prof. Mathias Forjan, PhD, MSc
● FH-Prof. Matthias Frohner, PhD, MSc
● Stefanie Gfeller
● Mag. pharm. Gunda Gittler, aHPh
● Dr. Reinhold Glehr
● Univ.-Prof. Dr. Michael Gnant
● Univ.-Prof. Dr. Richard Greil
● Servan L. Grüninger
● Prof. Dr. Sabine Hahn
● MMag. Astrid Jankowitsch
● Mag. Markus Kastelitz, LL.M., CIPP/E
● Wolfgang Keck
● Assoc.-Prof. Priv.-Doz. Mag. Dr. Peter Klimek
● Univ.-Prof. Dr. Daisy Kopera, EMBA, MEd.
● Dr. Silvia Maier
● Dietmar Maierhofer, BSc, MBA
● Dr. Tine Melzer
● Univ.-Prof. Dr. Stefan Nehrer
● Johannes Oberndorfer
● Dr. Verena Pfeiffer
● Helene Prenner, MA
● Dr. Erwin Rebhandl
● Prof. Dr. Reinhard Riedl
● Hon.-Prof. (FH) Dr. Bernhard Rupp
● FH-Prof. Dr. Stefan Sauermann
● Dr. Gerhard Schuster, MRICS
● Dr. Reinhold Sojer
● Univ.-Prof. Mag. Dr. Tanja Stamm, PhD, MSc, MBA
● Dr. Andreas Stippler
● Florian Stummer, MPH, MBA, MCHL
● Wolfgang Wagner
● Mag. DDr. Wolfgang Wein
● Mag. Ursula Weismann
● ao. Univ.-Prof. Dr. Beate Wimmer-Puchinger
● Annina Wüthrich
● Prim.-Doz. Dr. Erika Zelko


Daten sind das, was unsere Welt heute bestimmt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
UNIV.-PROF. DR. JOACHIM M. BUHMANN legte bei den PRAEVENIRE Gesundheitstagen im Stift Seitenstetten dar, wie Künstliche Intelligenz mithilfe von Algorithmen das menschliche Denken in Zukunft mitbestimmen wird. | von Wolfgang Wagner

Ein immer größer werdendes Datenvolumen beschreibt mittlerweile in der modernen Welt alle Aspekte der Realität. Das geht laut dem Schweizer Experten von der Astronomie mit Karten der Hintergrundstrahlung unseres Universums bis — z. B. — zur Computational Pathology. „Wir bearbeiten Daten seit den 1950er-Jahren mit der Hilfe von Computern. Das Entscheidende ist aber, dass diese Daten mit Werten in Verbindung gebracht werden. Dazu brauchen wir ein Hilfsmittel, und das sind die Algorithmen“, sagte Buhmann. Daten sind laut dem Wissenschafter „Facetten der Wirklichkeit“. Sie kommen in verschiedenen Formen vor. Das reicht in der Medizin von Genomdaten über die Informationen aus einem EKG, von histologischen Daten oder Informationen aus der bildgebenden Diagnostik bis hin zur herkömmlichen Patientenakte mit den Angaben über den klinischen Status. Ergänzt werde das heute auch noch durch Daten aus der „Selbstvermessung“ des Einzelnen (z. B. Fitnessuhren). Zwei große Problembereiche: Speicherung und Interpretation der Daten. Was durch die Digitalisierung laut Buhmann neu ist: „Sie bekommen Kontrolle durch Algorithmen. Dieser Kontrollaspekt ist das Entscheidende, das uns dazu bringt, dass wir über alle unsere Lebensbereiche neu nachdenken müssen. Diese Kontrolle durch Algorithmen bedeutet, dass Sie Modelle neu entdecken können, Hypothesen im sehr großen Maßstab testen und neue Lösungen fi nden können. Das wird von manchen Leuten heute als ‚intelligentes Denken‘ bezeichnet.“ Mit den Algorithmen als Abbildungen zwischen Daten und Entscheidungen (Werten) wird es möglich, ungeheure Mengen an Informationen zu verarbeiten.
Sie müssen die Algorithmen nicht schreiben, aber Sie müssen sie kontrollieren können.
Joachim M. Buhmann
Der Weg führt von Daten zu Informationen, Wissen und Werten, aus denen praktischer Nutzen gezogen werden kann, in der Medizin z. B. für Patientinnen und Patienten. Für diesen Prozess ist eine dramatische Reduktion der Datenmenge von hunderten Gigabyte bis zu für den Menschen begreifbaren Darstellungen notwendig. Dabei sind die Algorithmen, Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen die entscheidenden Werkzeuge. „Ein Algorithmus ist jede wohldefinierte Rechenvorschrift, die Daten als Eingabe annimmt und Werte als Ausgabe zurückgibt. Algorithmen erforschen mittlerweile von selbst unsere komplexe Realität. Künstliche Intelligenz ist das Besondere daran, indem sie uns davor bewahrt, die Komplexität verstehen zu müssen. Und Lerndende Maschinen beherrschen die algorithmische Induktion“, sagte Buhmann. Was mit künstlichen neuronalen Netzen begonnen hätte, welche die Lernfähigkeit biologischer Nervennetzwerke nachgebildet hätten, besitze mit Programmen wie „Deep Face“ eine um Dimensionen gesteigerte Leistungsfähigkeit. Entscheidend sei die Validierung der verwendeten Logarithmen. Einfach sei das noch, wenn Maschinen Aufgaben lösen, die der Mensch selbst auch lösen kann. Schwieriger werde es bereits beim überwachten Lernen — das Lösen von Aufgaben auf dem Menschen unbekannten Weg — das quasi im Nachahmen von Expertinnen und Experten besteht. Autonomes Lernen sei aber schließlich eine neue Qualität („Wir können die Aufgaben nicht lösen“): Hier setze die Kraft von Autonomem Lernen durch Self-Play ein. KI und Maschinelles Lernen und die Medizin Die Frage ist, wie diese Techniken die Medizin — auch den Arztberuf — in Zukunft verändern werden. Buhmanns Thesen: Gefährdet sei jedenfalls die Rolle der Ärztin bzw. des Arztes als „Medizinexpertin“ bzw. „Medizinexperte“ mit womöglich schlecht gewarteter Datenbank mit unzuverlässigem Zugri_ . Auch die Ärztin bzw. der Arzt als Wissensproduzent durch Erfahrung wird wohl Konkurrenz durch die KI bekommen. Der „Gesundheitshandwerker“ dürfte über die Robotik risikobehaftet sein. „Am ehesten resistentm“, so der Schweizer Wissenschafter, „ist die Ärztin bzw. der Arzt als Gesundheitsberater. Hier gibt es hohen Bedarf.“ Doch auch im letzteren Fall werden Ärztinnen und Ärzte in Zukunft neue Kenntnisse und Befähigungen benötigen. Buhmann: „Algorithmen und Künstliche Intelligenz werden Patientinnen und Patienten und ihren Gesundheitszustand beurteilen. Für die Ärztinnen und Ärzte bedeutet das, dass ein Grundverständnis der Algorithmen unverzichtbar ist. Sie müssen die Algorithmen nicht schreiben, aber Sie müssen sie einschätzen und kontrollieren können. Man braucht eine Ausbildung — wie man auch eine Ausbildung zum Autofahren benötigt, ohne ein Auto servicen zu können.“
Der „Digitale Zwilling“ als Ziel
Künstliche Intelligenz wird in Zukunft sowohl auf Patienten- als auch auf institutioneller Ebene das Gesundheitswesen entscheidend beeinflussen, erklärte DIETMAR MAIERHOFER (Connected Care & Healthcare Informatics/Philips) bei den 6. PRAEVENIRE Gesundheitstagen im Stift Seitenstetten. | von Wolfgang Wagner

Wo die sprichwörtliche „Reise“ im Gesundheitswesen mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz hingeht? — Womöglich zu einem „Digitalen Zwilling“ des Individuums in gesundheitlicher Hinsicht. Daten aus Genom-Profil, Bildgebung, Familienanamnese, klinischem Status und Labortests werden per KI-Algorithmen ausgewertet und erzeugen das gewünschte Modell für eine optimale Betreuung der einzelnen Patientin bzw. des einzelnen Patienten durch Ärztin oder Arzt bzw. Gesundheitsfachpersonal in an die jeweils aktuelle Situation angepasster Weise. „Wir wollen zu einem tieferen Verständnis des Zustandes der Patientin bzw. des Patienten kommen“, sagte Maierhofer.
KI hat gerade erst begonnen mit dem Menschen gleichzuziehen.
Dietmar Maierhofer
Hinzu könnten eine kontinuierliche und automatisierte Vorhersage der Situation des einzelnen genauso möglich werden, wie personalisierte Behandlungsempfehlungen, prädiktive Vermeidung von Risiken für Unfälle (z. B. Sturzgefährdung), Künstliche Intelligenz zur Ermöglichung von Robotik in der Chirurgie oder zur besseren und schnelleren klinischen Forschung bzw. Datenauswertung für die Entwicklung neuer Medikamente und Behandlungsmethoden. Das alles seien Schätze, die es per KI nun „vom Grund des Meeres“ zu heben gelte. Der zweite große Anwendungsbereich sei die betriebliche Ebene. Maierhofer: „Integrierte Daten für die Planung von Krankenhauskapazitäten und zur Vorhersage der zukünftigen Belastung sowie Hilfe für Klinikerinnen und Kliniker, um betriebliche Entscheidungen wie Bettzuweisung und Entlassung zu optimieren.“ Ein optimiertes Spitalswesen, auch im Sinne von „schlanken“ und bedarfsgerecht ausgerichteten Einrichtungen, werde dadurch möglich.
Hilfe, nicht Bedrohung
Künstliche Intelligenz sollte jedenfalls laut dem Manager zuvorderst als Hilfe, nicht als Bedrohung angesehen werden. „KI soll Menschen dabei helfen, große Datenmengen in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln.“ Im Gesundheitswesen gehe es dabei vor allem um: Verbesserung von Prozessabläufen, Patienten- Empowerment, Management im öffentlichen Gesundheitswesen (z. B. COVID-19-Pandemie) und um Decision Support, also um die Unterstützung von Ärztinnen und Ärzten und Fachpersonal bei Entscheidungen. Wobei die Entwicklung rasant fortschreite. „KI ist ein altes Thema. Den Begriff gibt es seit 1956. Aber sie hat gerade erst begonnen, mit der menschlichen Leistung gleichzuziehen, sie in einigen Fällen bereits zu übertreffen“, sagte Maierhofer. In Zukunft würden solche Systeme die menschliche Leistung und das logische Denken bei komplexen Aufgaben wohl in der Regel übertreffen und zu neuen Lösungen führen. Umfragen unter Expertinnen und Experten weisen bereits in die Zukunft: Aktuell wird KI zu 34,4 Prozent als wichtig für die Diagnostik (Bildgebung, Pathologie, Sequenzierung) eingeschätzt. Dann folgen klinische Entscheidungsfindung (21,3 Prozent) und Datenmanagement (11,5 Prozent). Für den Zeitraum in fünf bis zehn Jahren steht schon die klinische Entscheidungsfindung (40,4 Prozent) an erster Stelle, gefolgt von der Diagnostik (17,5 Prozent) und „Selbstversorgung“ der Patientinnen und Patienten sowie Triage/Diagnose (je 8,8 Prozent). Dabei ergibt sich durch KI von Wissenschaft bis hin zur routinemäßigen Anwendung die Möglichkeit für ein nahtloses Lebenszyklus- Management. Aus der Wissenschaft kommen die Modelle, erprobt und getestet werden sie mit Daten aus der Praxis — eine ständige Optimierung kann innerhalb der routinemäßigen Anwendung jederzeit erfolgen.


Artificial Intelligence fordert uns heraus
In der Onkologie werden in Zukunft ungeheure Datenmengen für bessere Ergebnisse verarbeitet werden müssen. Doch AI ist nicht ohne Bias, sagte UNIV.-PROF. DR. RICHARD GREIL (MedUni Salzburg) bei den 6. PRAEVENIRE Gesundheitstagen in Seitenstetten. | von Wolfgang Wagner

Der Onkologe erklärte: „Artificial Intellgence ist etwas, das uns herausfordert und Fragen an uns stellt, wer wir sind, was wir wollen, was wir tun können. Wenn wir aber eine noch bessere und lebenswertere Gesellschaft erreichen wollen, müssen wir an der Spitze der Entwicklung stehen.“ In den vergangenen beiden Jahrzehnten hätten die Datenmengen in Biologie und Medizin bereits enorm zugenommen. Sei es beim Human Genome Project mit der Sequenzierung des menschlichen Erbguts noch um drei Milliarden Basenpaare gegangen, rechne man bei der Sequenzierung des gesamten menschlichen Immunsystems bereits mit zehn-hoch-elf-mal so vielen Informationen wie bei der Human Genome Organisation (HUGO), die zu verarbeiten und interpretieren sein werden. Das müsse Auswirkungen auch auf die Onkologie haben. „Krebserkrankungen sind die komplexesten Erkrankungen, die wir kennen.“ Wenn man von der Beteiligung von nur 450 Genen ausgehe, liege die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Menschen die gleiche Erkrankung aufwiesen, bei unter einem Prozent. „Man kommt dazu, dass jeder Mensch seine ‚eigene‘ Krebserkrankung hat — und nach einem halben Jahr nicht mehr die gleiche wie vorher. Wir rechnen damit, dass wir in fünf Jahren für die Entscheidungen bei einer einzigen Patientin bzw. einem einzigen Patienten rund 10.000 Daten benötigen werden“, sagte Greil. Das sei auch der Grund, warum es der Entwicklung einer eigenen Onko-Mathematik bedürfe, um den Anforderungen einer solchen Komplexität entsprechen zu können.
Für die Entscheidungsfindung bei einer Patientin oder einem Patienten werden wir in fünf Jahren 10.000 Daten benötigen.
Richard Greil
Fortschritte in Bildanalyse
Ein Problempunkt sei jedenfalls die Extraktion der Daten aus den Krankengeschichten. Hier sei unter den gegebenen Voraussetzungen daran zu zweifeln, wie gut das gelingen könne. So benötige man auch Systeme, welche sprachliche Formulierungen berücksichtigen und Fehler korrigieren könnten. „Wir sehen erste Fortschritte mit Künstlicher Intelligenz dort, wo es um relativ einfache Dinge geht, z. B. in der Bildanalyse“, erklärte der Onkologe. Die Interpretation von Bildern aus CT, MR etc. könne aber nur ein erster Schritt sein. Es gehe um viel mehr. So würden die Daten aus der Bildgebung bisher dazu verwendet, der Ärtzin bzw. dem Arzt eine Darstellung zu vermitteln, die sie bzw. er zu interpretieren in der Lage sei, eben visuelle Bilder. Das müsse in Zukunft nicht mehr ausschließlich so sein. „Wenn wir Techniken hätten, mit denen wir aus radiologischen Untersuchungen einen genomischen Atlas der Heterogenität der Tumormanifestationen für eine einzelne Patientin oder einen einzelnen Patienten ableiten könnten, wäre das eine unglaublich wertvolle Information für eine individuelle Therapie.“ Verlässliche Rückschlüsse von den radiologischen Basisdaten auf die Genomik könnten somit einen entscheidenden Fortschritt bringen. Immer müsse sich die Gesellschaft aber auch der Probleme von Algorithmen und KI bewusst sein, betonte der Onkologe: „Alle Daten, die wir haben, bergen einen sozialen, politischen oder anderen Bias in sich. Wir brauchen auch Algorithmen, die diesen Bias eliminieren können.“
© PETER PROVAZNIK, PETRA SPIOLA, ETH ZÜRICH, MARKUS SPITZAUER, PRIVAT, PERIONLINEEXPERTS, BFH, PRIVAT, LUDWIG SCHEDL, FELICITAS MATERN, FHTW, BÜCHELE, GERRY NITSCH, MARA TRUOG











