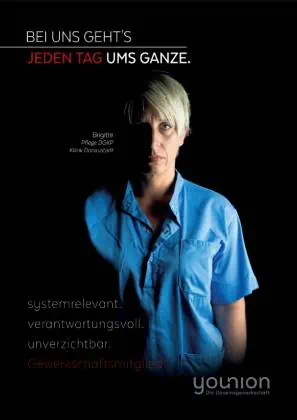Kommt es nicht zu einer grundlegenden Anpassung von Strukturen und Leistungserbringung, droht im österreichischen Gesundheitswesen ein Crash. Prophylaxe so früh wie möglich, optimale Versorgung extramural und „Ambulantisierung“ möglichst vieler Leistungen der Spitäler müssen ineinandergreifen, forderten führende österreichische Expertinnen und Experten bei der Vorstellung des PRAEVENIRE Jahrbuchs 2022/2023. Die Zeit drängt wie nie zuvor.

Wolfgang Wagner
Gesundheitsjournalist
Einen wichtigen Teil der PRAEVENIRE Initiativen stellt derzeit das Thema „Fokus Spital 2030“ dar. Neben vielen anderen namhaften Expertinnen und Experten federführend ist hier Dr. Wilhelm Marhold, von 2005 bis 2014 Generaldirektor des damaligen Wiener Krankenanstaltenverbundes. Der Gynäkologe mit jahrzehntelanger Erfahrung im österreichischen Spitalswesen anlässlich der Präsentation des Jahrbuchs der PRAEVENIRE Initiative Gesundheit 2030: „Es vergeht kein Tag, an dem nicht Mängel im österreichischen Spitalswesen in den Medien aufscheinen. Wie viele Pressemeldungen über Unzulänglichkeiten der Spitalsversorgung braucht es noch, bis sich etwas ändert?“
Der Experte nannte zu den aktuellen Problemen gleich mehrere schlagende Beispiele: „Die niederösterreichische Ärztekammer hat vor kurzem gemeldet, dass man in dem Bundesland derzeit ein Jahr auf eine künstliche Hüfte warten muss. Das ist zumeist keine Akutoperation, aber ein Jahr, das ist schon lang. Die Menschen haben ja Schmerzen.“
Für Experten kennzeichnen auch Nachrichten aus der Steiermark die Dramatik der Situation: „Von dort gab es vor wenigen Tagen Meldungen, wonach mehr als 600 freie Betten in den Abteilungen der KAGes-Spitäler gesperrt sind oder gesperrt werden sollen, weil das Personal fehlt bzw. überlastet ist.“ Das ist die Kapazität eines mittleren Zentralkrankenhauses. In Wien hat die Klinik Landstraße rund 700 Betten.“ In der Öffentlichkeit werde aber derzeit falsch reagiert, so Marhold: „Es macht keinen Sinn, mit dem ‚Flammenwerfer‘ herumzugehen und einmal die Ärzteschaft, einmal die Krankenkassen anzugreifen. Ich übe Kritik am System, nicht an den Ärztinnen und Ärzten oder den Mitarbeitenden im Pflegewesen, die dort arbeiten müssen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, fährt das System an die Wand.“ Das gelte für die Spitäler, laut vielen Expertinnen und Experten gilt das aber genauso für das österreichische Gesundheitswesen als Ganzes.
Betten-, Stationssperren und das Auflassen von Abteilungen sind kein Beitrag zum Strukturwandel.
Wilhelm Marhold
Strukturen der Entwicklung der Medizin anpassen!
Der wesentlichste Punkt, wie der Gynäkologe und erfahrene Krankenhausmanager darstellte: „Die moderne Medizin kann rascher und gezielter versorgen und braucht neue Strukturen für die Versorgung von Patientinnen und Patienten. Wir können die Medizin des Jahrhunderts nicht in Strukturen des 20. Jahrhunderts betreiben. Der enorme technologische Fortschritt der Medizin muss in der Organisation des Krankenhausbetriebes und in der Spitalsfinanzierung abgebildet werden.“ Derzeit reagiere das österreichische Gesundheitswesen auf Engpässe und Mängel kontraproduktiv, mit dem Sperren von Bettenstationen und Leistungskürzungen. Marhold pointiert: „Zum Zusperren holt man einen Schlosser. Spitalsmanager müssen kreative Lösungen für die Weiterentwicklung der Spitäler liefern. Bettensperren, Stationssperren und das Auflassen ganzer Abteilungen sind kein Beitrag zum Strukturwandel und generieren nur Versorgungsengpässe und Verluste der Versorgungs-, aber auch der Ausbildungsqualität.“ An sich sind die österreichischen Krankenhäuser gut ausgestattet. Rund 16,5 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern flossen 2021 in die österreichischen Spitäler. Doch Engpässe und Probleme in der Versorgung der Patientinnen und Patienten gibt es trotzdem.
Dringend gehörten die Strukturen im österreichischen Spitalswesen der modernen Medizin und den aktuellen Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten und der in den im intramuralen Bereich Tätigen angepasst. Marhold: „Wir müssen verkrustete Strukturen auflösen.“ Der wichtigste Reformschritt für die nächste Zukunft, und 2030 ist, wie viele Expertinnen und Experten betonen, ein bereits sehr knapper Zeithorizont für längst fällige Änderungen: „Wir brauchen eine ‚Ambulantisierung‘ von bisher stationär in den Spitälern erbrachten Leistungen. Wir müssen viel mehr auf tagesklinisch durchgeführte Eingriffe setzen. Dazu benötigen wir auch viel mehr tagesstationäre Einrichtungen, in denen Patientinnen und Patienten drei, sechs, neun oder zwölf Stunden, nicht aber über Nacht, betreut werden.“ Marhold sieht hier ein enormes Potenzial: „Es gibt in Österreich die Möglichkeit, pro Jahr rund 800.000 bisher stationär erbrachte Leistungen tagesklinisch durchzuführen. Nur 15 Prozent der Patientinnen und Patienten benötigen ein ‚Overnight-Treatment‘. Mehr ‚tagesstationär‘, weniger ‚nachtstationär‘. Wir sind derzeit nur bei rund 200.000 tagesklinisch durchgeführten Eingriffen. Die moderne Medizin ermöglicht, dass immer mehr Eingriffe schonender und ohne Notwendigkeit von stationären Aufnahmen durchgeführt werden. Das müssen wir in den Spitälern ermöglichen.“ Es gibt (mögliche) Vorreiter auf diesem Gebiet. Marhold: „Mit der laparoskopischen Chirurgie („Schlüsselloch“-Chirurgie; Anm.) lassen sich immer mehr Eingriffe schonender und ambulant durchführen. Das gilt für die Gynäkologie und die HNO genauso wie für die Bauchchirurgie, Orthopädie und viele andere Fachbereiche.“
Kein Tag vergeht ohne Medienmeldungen über Mängel in den Spitälern Österreichs.
Wilhelm Marhold
Funktionsdenken statt Bettendenken
Das bedeute aber ein Umdenken der Verantwortlichen im österreichischen Spitalswesen. „Wir müssen vom Bettendenken ins Funktionsdenken kommen“, forderte der Experte. Auch das Denken in fachspezifischen Bettenstationen sei veraltet. „Spitalsbetten sollten multidisziplinär belegt werden. Die Privatkliniken machen uns das vor“, meinte Marhold. Das ermögliche eine Optimierung des Personaleinsatzes und somit mehr Effizienz.
Für den Experten wäre eine solche Entwicklung mit erheblichen Vorteilen verbunden, es müssten jene Potenziale gehoben werden, welche die moderne Medizin biete. „Mit einer vermehrten tagesklinischen Versorgung fallen für das Pflegepersonal und die Ärztinnen und Ärzte Nachtdienste weg. Das gibt die Möglichkeit 20-, 30- oder 40-Stunden-Beschäftigungen nach den Bedürfnissen des Personals zu schaffen. Damit kann man eine bessere und auch geforderte Work-Life-Balance ermöglichen.“ Tagesarbeit sollte zu einem bisher unbekannten Ausmaß die belastenden Nachtdienste im Spital ersetzen und so die Lebensqualität und Zufriedenheit von Pflege- und Ärztepersonal erhöhen. Marhold: „Neue Spitalsstrukturen sind im Interesse des Personals und im Sinne von besseren Einsatzzeiten. Der ‚Ärztemangel‘ in den Spitälern ist selbst gemacht. Man hat die Auswirkungen der EU-Arbeitszeitrichtlinie in den Spitälern unterschätzt. Man hat die Auswirkungen des Themas ‚Work-Life-Balance‘ der nachkommenden Generation von Ärztinnen und Ärzten unterschätzt.“
Im Endeffekt habe man damit auch die Fehlzeiten von (ärztlichem) Personal in den Krankenhäusern falsch berechnet. Da gehe es um Teilzeit, Karenzierungen, Fortbildungen, Zeitausgleich etc. Verschärft hat sich das noch in den vergangenen drei Jahren durch die Pandemie-Krankenstände. Die Anzahl der Dienstposten sei zwar aufgestockt worden, aber seit Jahren zu gering. „Die Medizin-Universitäten bilden nach den Einschätzungen der eigenen Kapazitäten aus und nicht nach dem gesellschaftlich relevanten Bedarf. Wir haben in Österreich paradoxerweise – bezogen auf die Bevölkerungszahlen – mehr Medizin-Studienplätze als die Schweiz oder Deutschland, aber trotzdem einen ‚Mangel an Ärztinnen und Ärzten‘.“ Hier kommen laut dem Experten aber auch noch zwei weitere Faktoren zum Tragen: „Die Abwanderung nach dem Medizinstudium ins Ausland ist enorm und größer als der Zuzug nach Österreich. Die postpromotionelle Ausbildung ist für Jungärztinnen und -ärzte im Ausland offenbar attraktiver als jene in Österreich.“

Andere Finanzierungsmechanismen notwendig
Freilich, die Spitäler und ihre Beschäftigten – genauso die Träger der Krankenhäuser, in Österreich zumeist die Bundesländer – dürfen bei den notwendigen Änderungen im Großen und im Detail nicht allein gelassen werden. So ist für die notwendige „Ambulantisierung“ der Spitalsmedizin auch das Finanzierungssystem der Krankenhäuser umzustellen.
Die in Zukunft vermehrt tagesklinisch durchzuführenden medizinischen Leistungen an Patientinnen und Patienten müssten gemäß eines detaillierten Leistungskatalogs bezahlt werden und dürften nicht „in Ambulanzpauschalen“ untergehen, so Marhold. So könnten die entsprechenden Anreize für die Spitalserhalter geschaffen werden. Immerhin koste ein über Nacht belegtes Spitalsbett in Österreich derzeit im Durchschnitt rund 1.100 Euro, haben Expertinnen und Experten errechnet. Sinnvollerweise sollten Finanzierung und Strukturplanung bzw. Steuerung im Gesundheitswesen in einer Hand liegen, meint der Wiener Fachmann. Die Ausformung müsse eben verhandelt werden. „Den enormen medizintechnologischen und medizinwissenschaftlichen Fortschritt muss man im Spitalsmanagement wirtschaftlich und strukturell abholen“, lautete deshalb eine Hauptforderung des ehemaligen Chefs der städtischen Wiener Spitäler.
Tausende warten auf ihre geplanten Eingriffe für Knie- und Hüftgelenks-Endoprothesen.
Andreas Stippler
Barrieren niederreißen!
Für eine strukturelle Reform im österreichischen Gesundheitswesen ist aber auch das Niederreißen von Barrieren notwendig. Mag. Karl Lehner, Geschäftsführer der OÖ Gesundheitsholding: „Die Spitäler sind die Spitze der Pyramide des Gesundheitswesens. Wir müssen uns wesentlich mehr damit beschäftigen, dass wir die Sektorengrenzen in unserem Gesundheitswesen überschreiten. Wir haben Betonwände zwischen den Sektoren.“
Es müsse für die am Gesundheitswesen beteiligten Institutionen und Berufsgruppen viel leichter möglich werden, gemeinsam Initiativen zu setzen. Lehner: „Warum sollten ein Spital, eine niedergelassene Radiologin, ein niedergelassener Radiologe nicht gemeinsam ein Großgerät, zum Beispiel einen Magnetresonanztomografen, betreiben? Warum sollte eine Primärversorgungseinheit nicht im oder vor den Toren eines Spitals betrieben werden können? Wir haben in Österreich keine Kultur des Gate-Keeping. Wenn wir aber keine Kultur des Gate-Keeping haben, schlage ich vor, die Patientinnen und Patienten dort zu empfangen, wo sie ankommen.“
Klar sei, dass das Krankenhaus für Akutfälle bereit sein müsse. Doch chronisch Kranke etc. sollten eben ambulant bzw. im niedergelassenen Bereich versorgt werden. „Wir könnten uns dadurch eine Menge Geld, Ineffizienzen und Fehlsteuerungen ersparen“, betonte Lehner. Das könnte schließlich auch zu einer Reform in der Finanzierung führen, sagte der Experte: „Wenn wir diese Sektorengrenzen angehen, wäre es auch möglich, den spitalsambulanten und den niedergelassenen Bereich aus einem Topf zu finanzieren.“ Zusätzlich müsse es auch in Österreich möglich werden, die Menge an vorhandenen Daten anonymisiert für Planung und Steuerung zu nützen. „ELGA muss wesentlich effizienter werden.“
Schließlich seien auch wesentliche Verbesserungen im Bereich der Ausbildung für Gesundheitsberufe notwendig. „Wir müssen danach trachten, eine Ausbildung ab dem Alter von 15 Jahren zu haben. Wir brauchen Teilzeit- und berufsbegleitende Formen der Ausbildung – von der Pflegeassistenz bis zum Bachelor. Wenn jeder Lehrling für seine Ausbildung bezahlt wird, sollte das auch für die Gesundheitsberufe gelten“, so Lehner.
Wir haben Betonmauern zwischen den einzelnen Sektoren im Gesundheits- wesen.
Karl Lehner
Beispiel Orthopädie
Wie kommt man zu weniger Spitalsfrequenzen? Wie können Wartelisten für notwendige Eingriffe wieder abgebaut werden? Ein Beispiel für die derzeitige teilweise dramatische Situation inklusive möglicher Lösungsvorschläge bietet die Orthopädie in Österreich.
Derzeit mangelt es an allen Ecken und Enden, wie Dr. Andreas Stippler, MSc Bundesfachgruppenobmann für Orthopädie und chirurgische Orthopädie darstellte: „Es gibt große Probleme für unsere Patientinnen und Patienten. Tausende warten auf ihre geplanten Eingriffe. Allein im Krankenhaus Stockerau (NÖ; Anm.) ist die magische Grenze von 1.000 auf geplante Eingriffe wartenden Patientinnen und Patienten überschritten.“ Die Situation sei einfach als „prekär“ zu bezeichnen, sagte der Bundesfachgruppenobmann. Die Ursache klingt sprichwörtlich „banal“, ist es aber nicht. Stippler: „Dort fehlen die OP-Pflegerinnen und -Pfleger, welche die Patientinnen und Patienten von den Zimmern in den Operationssaal schieben und wieder zurück.“
Die Ursachen für Chaos und chaotische Zustände seien vielfältig, wie der Bundesfachgruppenobmann erklärte. „Einerseits gibt es seit der Coronapandemie viele ‚Aufholoperationen‘. Viele Abteilungen sind in den Zeiten der Pandemie zu Corona-Abteilungen umgewandelt worden. Das hat zu einem ersten Rückstau an Operationen geführt.“ Der zweite Grund: „Das Personal ist ausgepowert. Nicht nur die Ärztinnen und Ärzte, auch die Pflegekräfte. Hier fehlt es an Personal. Dadurch kommt es zu den Tausenden Patientinnen und Patienten, die auf ihre geplanten Knie- und Hüftgelenksoperationen und somit auf Befreiung von ihren Schmerzen warten.“

OECD-Zahlen
Die Zahlen des OECD-Berichts „Health at a Glance“ (2022) mit dem Vergleich der wesentlichen Daten für das Gesundheitswesen der Mitgliedsländer der Organisation sprechen zu diesen Feststellungen eine deutliche Sprache: 2019 lag demnach Österreich mit 229 Knie- oder Hüftgelenksendoprothesen pro 100.000 Einwohner an zweiter Stelle bei der Frequenz dieser Operationen in der EU. An erster Stelle war Finnland (242/100.000).
Unter den OECD-Mitgliedsländern lag nur noch die Schweiz mit 260 solcher Eingriffe pro 100.000 über diesem Wert und damit am ersten Rang. Während aber in Finnland die Frequenz im Jahr 2020 nur auf 235/100.000 Einwohner zurückging und in der Schweiz mit 256/100.000 ebenfalls praktisch unverändert blieb, stürzte Österreich auf 181 Operationen pro 100.000 Einwohner ab. Das lässt erkennen, woher in Österreich der nunmehrige Nachholbedarf kommt. Der OECD-Durchschnitt für diese Eingriffe lag 2019 bei 133/100.000 Einwohner, im Jahr darauf bei 104, was jedenfalls auch insgesamt für einen Corona-bedingten Rückgang spricht.
Wenn wir jeden Lehrling in der Ausbildung bezahlen, muss das auch für die Gesundheitsberufe gelten.
Karl Lehner
Strukturelle Probleme
Bei langen Wartelisten im Bereich der elektiven Eingriffe schlägt aber noch eine weitere – dieses Mal strukturelle – Bedingung zu. Stippler: „Dazu kommt auch noch, dass die Fächer für Orthopädie und Traumatologie zusammengelegt worden sind. Wir haben damit auch ein Strukturproblem. Durch diese Zusammenlegung ist es zu einer Verringerung der Kapazitäten für geplante Operationen gekommen. Wir müssen immer wieder einen Operationssaal freihalten, um unfallchirurgische Patientinnen und Patienten versorgen zu können.“ Ein zusätzliches Problem, so der Bundesfachgruppenobmann: „Wir haben im niedergelassenen Bereich auch zu wenige Angebote in der konservativen Orthopädie. Wir sind im internationalen Vergleich Europameister im Operieren von Knie- und Hüftgelenken mit Endoprothesen. Es fehlen aber im niedergelassenen Bereich die Alternativen, um Patientinnen und Patienten mit Hüft- und Kniegelenksendoprothesen adäquat versorgen zu können. Das Problem zieht sich von der Ausbildung zu den Operationskapazitäten bis hin zu mangelnden Strukturen im niedergelassenen Bereich.“
Vielfältiges Maßnahmenpaket notwendig
Zur Behebung der Schwierigkeiten bedürfe es jedenfalls vielfältiger Maßnahmen, sagte der Bundesfachgruppenobmann. Diese müssten auch darauf abzielen, möglichst wenige Patientinnen und Patienten in eine Lage kommen zu lassen, in der nur noch der künstliche Gelenksersatz helfen kann. „Wir brauchen strukturierte und evidenzbasierte Angebote für Personen mit Knie- oder Hüftgelenksarthrose. Da gibt es ermutigende Zahlen aus Dänemark und Australien.“
Man könne durch eine optimale konservative Versorgung wohl auch den großen zahlenmäßigen Anfall von Patientinnen und Patienten für die Versorgung künstlicher Gelenke in bestimmten Grenzen halten. Gleichzeitig gelte es aber auch, die Operationskapazitäten auszubauen. „Die Zahl der Operationen wird trotzdem immer mehr steigen, weil immer mehr Patientinnen und Patienten aus der Baby-Boomer-Generation in die Pension und damit ins Alter kommen, in dem diese orthopädischen Eingriffe nachgefragt werden. Wir brauchen also mehr Ausbildung, nicht nur im operativen, sondern auch im konservativen Bereich, um die Patientinnen und Patienten insgesamt besser betreuen zu können“, sagte Stippler. Am Willen der österreichischen Orthopädinnen und Orthopäden mangle es nicht, so Stippler: „Wir reichen der Politik die Hände und ersuchen um Lösungen.“
Abonnieren Sie PERISKOP gleich online und lesen Sie alle Artikel in voller Länge.