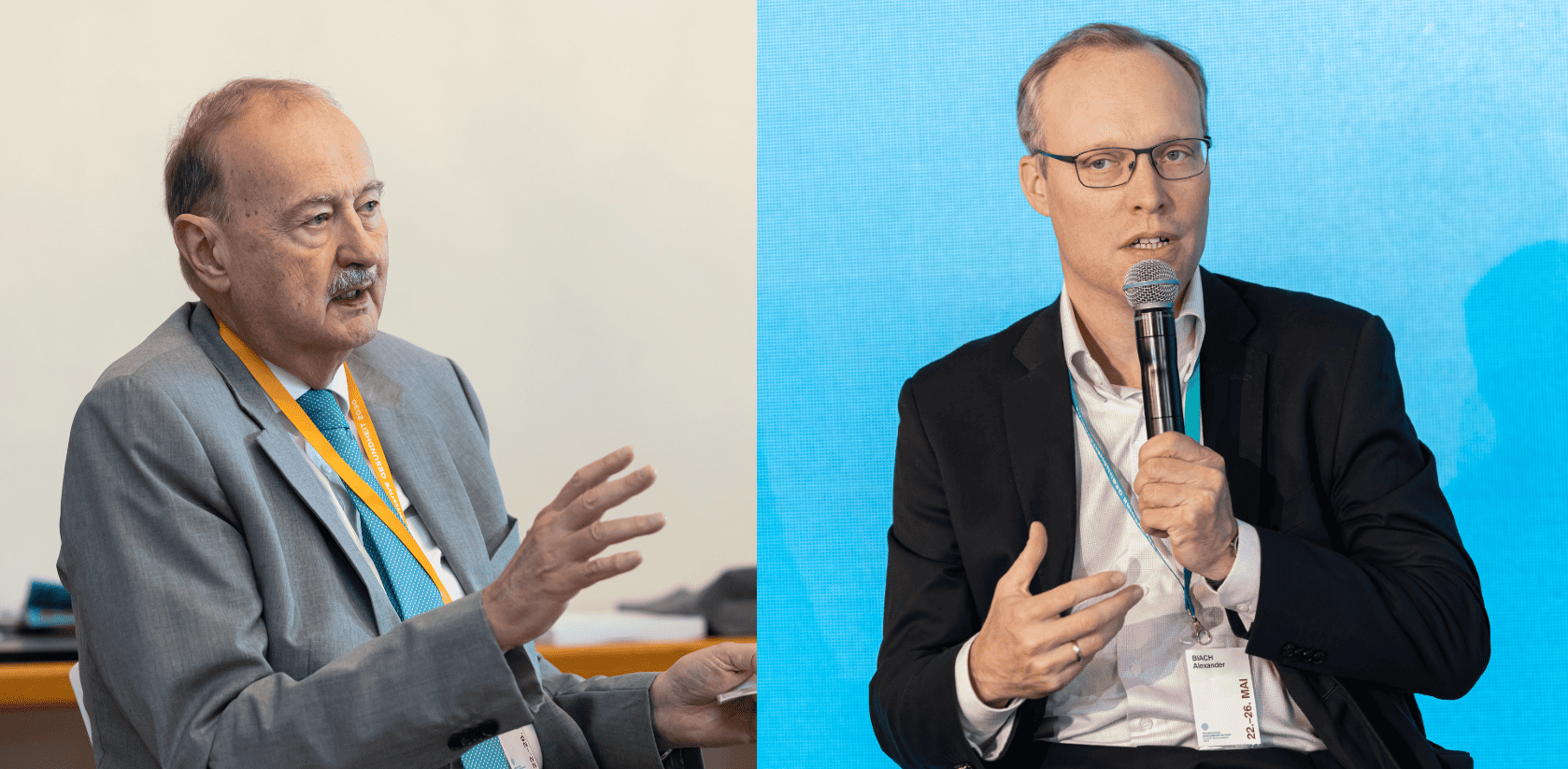PRAEVENIRE Expertinnen und Experten mit neuem Vorschlag: Der Bund soll die Ausbildung von 120 zusätzlichen Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmedizinern an den österreichischen Universitätskliniken bezahlen. Dr. Wilhelm Marhold: „Wir stehen vor einer enormen Pensionierungswelle.“ Schnelles Handeln wäre deshalb nach dem Vorbild der „Leodolter-Stellen“ vor einigen Jahrzehnten notwendig.

Wolfgang Wagner
Gesundheitsjournalist
In Österreichs Spitälern fehlt es akut vor allem an Pflegekräften. In der niedergelassenen Praxis aber kommen dem Land zunehmend die Hausärztinnen und Hausärzte – also die Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag – abhanden. Der Ruf nach mehr Ausbildungsplätzen für das Medizinstudium wurde bisher von den Rektoren der medizinischen Universitäten in Österreich negativ beurteilt. Es hilft wenig, mehr Medizinabsolventinnen und Medizinabsolventen zu „produzieren“, wenn sie dann nicht für die medizinische Versorgung der Bevölkerung extramural, also in der niedergelassenen Praxis, tätig werden.
Keine Frage, die gesundheitspolitischen Diskussionen haben infolge der akut aufgebrochenen vielfältigen Probleme in jüngster Zeit deutlich an Schärfe zugelegt. Doch das ändert noch nichts an der Problemlage. Dr. Wilhelm Marhold, ehemals Chef des Wiener Krankenanstaltenverbundes und Manager im Gesundheitsbereich mit jahrzehntelanger Erfahrung, bei einem PRAEVENIRE Hintergrundgespräch: „Da macht jemand einen Vorschlag – und über den fallen dann die anderen her.“ Das bringe einfach nichts.
Die PRAEVENIRE Gesundheitsinitiative, so Marhold, biete hier einen Kontrapunkt: „Das ist eine Initiative, in welcher die Ideen von Expertinnen und Experten gesammelt werden. Da kommt etwas an konkreten Vorschlägen für Maßnahmen heraus.“
Schnelle Maßnahmen notwendig
In Sachen Allgemeinmedizin fehlt es derzeit dringend an Nachwuchs für Hausärztinnen und Hausärzte, die später im Rahmen von Kassenverträgen für die medizinische Primärversorgung der Bevölkerung tätig werden. Die offiziellen Daten: Zum Jahresbeginn 2023 waren österreichweit 300 Kassenstellen unbesetzt – 176 Stellen für Allgemeinmedizin sowie 124 Facharztstellen. Wenn man davon ausgeht, dass die meisten gesundheitlichen Probleme zunächst einmal von Hausärztinnen und Hausärzten diagnostiziert und behandelt werden können, schlägt der Mangel in diesem Bereich besonders an. Bei den Fachärztinnen und Fachärzten waren weiterhin die Kinderheilkunde (29 offene Stellen), Frauenheilkunde (23) sowie Augenheilkunde (16) die größten „Sorgenkinder“, übrigens auch hier ausgesprochen „breitenwirksame“ Fachgebiete der Medizin. Die Zukunft verheißt nichts Gutes.
Marhold: „Wir stehen vor einer enormen Pensionierungswelle (unter den niedergelassenen Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmedizinern; Anm.) in den kommenden sieben bis zehn Jahren.“
Dr. Alexander Biach von der Wirtschaftskammer Wien, ehemals Chef des damaligen Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger (jetzt „Dachverband“), untermauerte das mit harten statistischen Daten: „Die derzeitige gesundheitspolitische Diskussion spiegelt die Situation nicht wider. Die Zahl der Ärztinnen und Ärzte ist in den vergangenen Jahren fast zweimal so stark gestiegen wie die Zahl der Bevölkerung. Im niedergelassenen Bereich haben wir aber ein All-Time-Low.“
Während es in den österreichischen Spitälern deutlich mehr Ärztinnen und Ärzte als früher gebe, hinke die Zahl der Ärztinnen und Ärzte in der niedergelassenen Kassenpraxis hinter- her, so der Experte. Das ist unabhängig davon zu sehen, ob diese schließlich in Einzel- oder Gruppenpraxen oder gar in Primärversorgungseinheiten (PVE) tätig sind. Hier die von Biach präsentierten Daten im Einzelnen:
- Die größten Altersgipfel bei den österreichischen Ärztinnen finden sich im Bereich von 46 und dann schon bei 60 Die Ärzte haben den größten Altersgipfel bei um die 64 Jahre. Der zweithöchste Gipfel bei den Ärzten ist mit um die 48 Jahre deutlich niedriger, aber ebenfalls bereits in Richtung höheres Alter verschoben.
- Die Zahl der Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner hat in Österreich zwischen 2000 und 2022 von 650 auf 12.942 zugenommen.
- Die Zahl der Hausärztinnen und Hausärzte mit Kassenvertrag ist von 228 im Jahr 2000 auf 3.990 gesunken.
- Auf der anderen Seite hatte Österreich im Jahr 2000 genau 33.939 fertig ausgebildete Ärztinnen und Ärzte Im Jahr 2022 waren es bereits 52.657.
- Gleichzeitig hat die Bevölkerung von 0098.212 (2000) auf nunmehr 8.978.929 (2022) zugenommen.
- Im Jahr 2000 gab es in Österreich 4,24 Ärztinnen und Ärzte pro 1.000 Einwohner- innen und Einwohner, im Jahr 2022 waren es 5,86. Die Quote bei den Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmedizinern stieg nur leicht von 1,33 auf 1,44 pro 1.000 Einwohnerinnen und
- Schlecht sieht die Quotenentwicklung bei den Hausärztinnen und Hausärzten (Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag) aus: Sie sank von 0,53 pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner zur Jahrtausendwende auf nunmehr nur noch 0,44 (2022).
Biach: „Wir haben immer mehr Ärztinnen und Ärzte in den Spitälern. ‚Draußen‘ aber haben wir einen massiven Rückgang, was den Kassenbereich angeht.“ Gruppenpraxen, die Unterstützung von Ordinationsgründungen und der gewünschte starke Ausbau von PVE sollen die Mangelsituation verbessern. Doch ohne Hausärztinnen- und Hausärztenachwuchs wird das alles nicht gehen.
Marhold will dieses Problem mit einem Konzept der ersten Gesundheitsministerin, Primaria Dr. Ingrid Leodolter (Amtszeit: 1971 bis 1979), angehen. Sie hatte Ende der 1970er-Jahre in Zeiten einer „Ärzteschwemme“ neue Maßnahmen ergriffen: Als damals die Baby-Boomer vermehrt die Fakultäten der Universitäten frequentierten, gab es für die notwendige nachfolgende Spitalsausbildung der Medizinabsolventinnen und -absolventen jahrelange Wartezeiten. Ihr Projekt: An den Universitätskliniken wurden vorübergehend Ausbildungsstellen für Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner mit einem von vier auf drei Jahre verkürzten Turnus geschaffen und vom Gesundheitsministerium bezahlt. Analog dazu sollte laut Marhold jetzt gehandelt werden: „Derzeit ‚verzichten‘ wir an den Universitätskliniken auf die Ausbildung von Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmedizinern. Unser Vorschlag ist ein Projekt mit 120 Dienstposten an den Universitätskliniken der medizinischen Universitäten in Österreich. Sie sollte der Bund bezahlen. Es kostet den Dienstgeber pro Auszubildendem brutto rund 100.000 Euro im Jahr. Damit kommen wir auf 12 bis 13 Millionen Euro. Das wäre ein Paket für eine Ausbildung von fünf Jahren.“
Ich bin dafür, auch selbst- ständige Ambulatorien als PVE auf Beschluss einer Landesregierung und mit Verträgen der Krankenkassen zu etablieren.
Alexander Biach
Der Gynäkologe, der viele Jahre Studenten- und später Ärztevertreter sowie Ärztlicher Direktor der Wiener Rudolfstiftung (nunmehr Klinik Landstraße) und anschließend Krankenanstaltenverbund-Generaldirektor war, will damit vor allem die akute Situation verbessert sehen: „Es soll eine rasche Maßnahme sein. Sie ist leicht zu realisieren. Man könnte an solche Stellen in Wien, Graz, Innsbruck, Salzburg und Linz denken.“ Überall dort befinden sich medizinische Universitäten, die jetzt einspringen könnten.
Sichergestellt werden müsse, dass durch dieses Programm Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner für den niedergelassenen kassenvertraglichen Bereich ausgebildet werden. Das war auch unter Ministerin Leodolter der Fall. Die Absolventinnen und Absolventen der damaligen zusätzlichen Ausbildungsstellen an den Universitätskliniken mussten nach drei Jahren die Spitäler wieder verlassen. Marhold nannte ein in der österreichischen Politik bekanntes Beispiel: „Auch Dr. Erwin Rasinger (langjähriger ÖVP-Gesundheitssprecher und Hausarzt in Wien; Anm.) hat damals eine solche Ausbildung am Wiener AKH absolviert.“ Die teilnehmenden Universitätskliniken hätten mit den neuen Ärztinnen und Ärzten in Ausbildung zur späteren Laufbahn als Hausärztinnen und Hausärzte wiederum den Vorteil, mehr ärztliches Personal für Stationsarztposten zu haben.
Interesse an AllgemeinmedizinAusbildung?
Im Hintergrund aller dieser Diskussionen stehen natürlich auch die Interessen der österreichischen Krankenhäuser. Bei bereits erfolgtem Anlaufen der Pensionierungswelle unter den österreichischen Ärztinnen und Ärzten aus der Baby-Boomer-Generation mit den Jahrgängen bis etwa 1960 sorgen auch sie sich um „ihren“ Nachwuchs. Und für die Krankenhäuser steht die Ausbildung von zukünftigen Fachärztinnen und Fachärzten für den Spitalsbetrieb naturgemäß im Vordergrund.
Eines sei klar, so Marhold: Nur mit schnell wirksamen Maßnahmen – wie eben den Ausbildungsstellen an den Universitätskliniken – ließe sich auch schon ab den nächsten fünf Jahren an den richtigen Rädern drehen, um die Personalsituation in der Kassen-Allgemeinmedizin zu verbessern. Derzeit dauert die Ausbildung zur Ärztin bzw. zum Arzt für Allgemeinmedizin mindestens 42 Monate.
Anhaltender Bedarf existiert aber auch für neue Modelle in der niedergelassenen medizinischen Versorgung. Das ist sozusagen der zweite Angelpunkt, an dem es anzusetzen gilt. Biach: „Ich glaube, es geht bei der Ausgestaltung der Kassenverträge vor allem um die Frage der Lebensqualität.“ 70 Prozent der fertig ausgebildeten Ärztinnen und Ärzte wollten laut Umfragen in der niedergelassenen Praxis „unselbstständig“ arbeiten. Viele würden sich eine Einzelordination mit den wirtschaftlichen Risiken nicht zutrauen. Teamarbeit sei gefragt. Die Ärztinnen und Ärzte wollten sich auch zunehmend nicht um die Kassenabrechnungen und die Organisation kümmern, sondern auf ihre ärztliche Tätigkeit konzentrieren.
Biachs Vorschlag: „Ich bin dafür, auch selbst- ständige Ambulatorien als PVE auf Beschluss einer Landesregierung und mit Verträgen der Krankenkassen zu etablieren.“ Diese sind standesrechtlich nicht in der Ärztekammer, sondern in der Wirtschaftskammer verortet, das sollte aber kein Hinderungsgrund sein. So wäre die Bildung von multiprofessionellen Teams – von der Labormedizin über die Chirurgie bis hin zur Allgemeinmedizin – auch mit verschiedenen anderen Berufsgruppen und in Anstellungsverhältnissen für das Personal leichter möglich. Das Risiko für die einzelnen Ärzte und anderen Gesundheitsberufe wird durch Anstellung in der Gesellschaft minimiert – ein gravierender Unterschied zu Grup- penpraxen. Eine reine Kommerzialisierung sei bei Kontrolle durch die Landesregierungen und mit den Verträgen durch die Krankenkassen durchaus zu verhindern.
Unser Vorschlag ist ein Projekt mit 120 Dienstposten an den Universitätskliniken der medizinischen Universitäten in Österreich.
Wilhelm Marhold
Laut Biach sollte das alles aber Einzelordi- nationen von Ärztinnen und Ärzten nicht an die Wand drängen. Es ginge bloß um ein möglichst breites Spektrum an Berufsoptionen für die Hausärztinnen und Hausärzte der Zukunft. Gleichzeitig müsse die Digitalisierung in der medizinischen Versorgung mit verstärkter Funktion von Dienstleistungen, wie der 1450-Hotline, in Gesundheitsfragen voran- getrieben werden.
Marhold ergänzte: „Auch die ‚Gesundheitswirtschaft‘ ist ein Markt. Die Menschen stimmen mit den Füßen ab. Sie gehen dorthin, wo sie am einfachsten eine Versorgung bekommen. Es geht um Patienteninformation, nicht um Steuerung.“ Die immer wieder erzählte „Mär“ von Patientinnen und Patienten, die mit banalen Gesundheitsproblemen in die Ambulanzen von Universitätskliniken kommen, sei nicht auf Böswilligkeit oder Bequemlichkeit, sondern auf einen Mangel an Wissen in Gesundheitsfragen zurückzuführen.
Vorsichtig positiv äußerte sich zu den Vorschlägen der PRAEVENIRE Gesundheitsinitiative bezüglich der zusätzlichen Ausbildungsstellen der Rektor der MedUni Wien, Univ.-Prof. Dr. Markus Müller: „An sich ist das eine interessante Idee. Wir haben an den Universitätskliniken der MedUni Wien bereits Teil-Anerkennungen als Ausbildungsstätten (auch für angehende Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner; Anm.) durch die Ärztekammer. Das könnte man weiter ausbauen.“ Es dürfe aber mit der geplanten Etablierung von Fachärztinnen und Fachärzten für Allgemeinmedizin nicht der Eindruck von Fachärztinnen und Fachärzten zweiter Klasse entstehen. Das will auch Marhold verhindert sehen, wenn es wieder zu „Leodolter-Stellen“ an den Universitätskliniken kommen sollte.
Abonnieren Sie PERISKOP gleich online und lesen Sie alle Artikel in voller Länge.